Michael Jastram
Betritt man das Atelier von Michael Jastram überwältigt einen die Farbe Weiß. Alles scheint weiß zu sein. Die Sonne durchflutet das Atelier von zwei Seiten und lässt das Weiß noch viel weißer erscheinen
Das großzügegige Atellier liegt im vierten Stock hinter der S-Bahn, - ganz am unteren Rand des Sprengelkiezes. Man hätte nicht erwartet hier ein Atelier zu finden. Versteckt im Hinterhof erwartet man eher Handwerksbetriebe, oder Autowerkstätten.






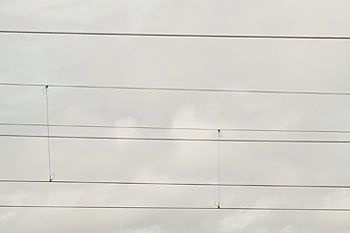













Guten Tag Herr Jastram, wer sind Sie?
Ich bin ein Berliner Bildhauer, in Berlin geboren, was im Künstlerbereich ja nicht gerade alltäglich ist. Ich habe alles in Berlin gemacht: zur Schule gegangen, studiert, jetzt arbeite ich hier im Wedding.
Können Sie Ihre Arbeit beschreiben?
Meine Arbeit hat sich mit den Jahren sehr verändert. Verletzlich und schwer waren meine Arbeiten, aber sie sind jetzt stiller, beweglich und leichter geworden. Die Schwere ist aus den Figuren raus. Das finde ich gut, denn diese Schwere, die Berlin hatte, ist in eine Leichtigkeit umgewandelt. Die gleichzeitige Beweglichkeit der Stadt gefällt mir, das transportieren auch meine Skulpturen.
Haben Sie auch schon mit anderen Medien gearbeitet oder waren Sie der klassischen Bildhauerei immer treu?
Ich bin der Bildhauerei eigentlich immer treu geblieben. Eine Zeitlang habe ich die Figur vernachlässigt und alles reduziert, bis auf zwei Säulen - zwei reduzierte Beine. Das war dann aber auf die Dauer etwas langweilig, der Wiederholungsbedarf hielt sich in Grenzen. Ich habe mich dann wieder auf die Figur besonnen. Die Figuren wurden immer kleiner, um sie herum entstand ein Gestell, Gefährt, eine Architektur. Und wie in Berlin wurde die umgebende Architektur immer gewaltiger.
Ihre Figuren haben keine geschlossenen Oberflächen, sie scheinen offen, porös. Warum?
Haut kann ich nicht modellieren, das kann der große Meister im Himmel viel besser. Ich möchte den Menschen, die Haut als verletzlich zeigen. Wir tragen unsere Haut zu Markte, wir zeigen sie im Berufsleben, auf der Straße oder unserem Partner gegenüber. Ich kann nur eine Ahnung davon schaffen, wie verletzlich wir Menschen sind. Jeder Mensch ist knackbar, physisch wie psychisch. Das bringen meine Figuren zum Ausdruck. Darum sind meine Figuren teilweise in sich, in ihrer Physiognomie gebrochen.
Welche Rolle spielt für Sie die Farbe Weiß?
Ich habe Gips als meinen Werkstoff gefunden. Früher habe ich es sehr geliebt, in Stein zu arbeiten, eine Zeitlang auch mit Holz. Aber dieser Gips, den kann ich weich wie Ton modellieren. Oder ihn wie einen Stein bearbeiten, mit Beilen oder Raspeln. Ich habe den harten Widerstand und die Modulation in einem Produkt, das ist sehr reizvoll. Und es hat den großen Vorteil, dass ich eine fertige Skulptur nicht noch umgießen muss. Glücklicherweise bin ich auf den Trichter gekommen, Stahl und Gips zu verwenden.
Wie lange arbeiten Sie schon hier im Wedding?
Im Wedding arbeite ich seit 2002. Zuvor hatte ich ein senatsgefördertes Atelier. Aufgrund des Rotationsprinzips musste man nach einer gewissen Zeit das Atelier räumen, damit Absolventen und junge Künstler auch die Chance auf preiswerten Raum zu haben. Ich wollte einen Raum, den ich bequem erreichen kann, deshalb ist dieser hier ein Glücksfall. Mit dem Rad brauche ich zehn Minuten von meiner Wohnung, die genau an der Grenze zwischen Wedding und Mittel liegt. Mein jetziges Atelier ist sehr groß und auch teuer für Berliner Verhältnisse. Aber im Bundesvergleich oder wenn man auf andere Metropolen wie London oder New York schaut, dann ist so ein Raum im Zentrum traumhaft. Gerade wenn Sammler kommen, kann ich sagen: ich bin 10 Minuten vom Hauptbahnhof weg und zehn Minuten von der Kanzlerin. Also, ich glaube, der Wedding hat ganz großes Potenzial.
Was mögen Sie am Sprengelkiez?
Die Lage ist optimal: Wenn ich zu Hause eine Idee habe, kann ich immer schnell noch mal hinflitzen. Und mein Besuch ist in Nullkommanichts bei mir, das ist der ganz große Vorteil.
Sie sind durch und durch Berliner, kommt Ihr Publikum auch von hier?
Lange Zeit gar nicht, das hat sich in den letzten Jahren aber gebessert. Wahrscheinlich, weil wir eine gute Blutzufuhr haben von vermögenden oder kunstinteressierten Leuten. Aber das hat Berlin immer gut getan, es war immer ein Schwamm. Für die Hugenotten, die das Uhrmacherhandwerk und andere wunderbare Sachen hergebracht haben. Oder im 19. Jahrhundert die vielen jüdischen Menschen, die diese Stadt mit Kunstverstand hochgebracht haben. Bis 1933 war das ja eine wunderbare Zusammenarbeit zwischen Kunstsinn und Kapital. Denken Sie an Beckmann oder Liebermann, Cassirer, Flechtheim. Die förderten die Künste hochgradig. Nicht nur die erwünschte, sondern auch die Avantgarde. Ich hoffe, dass das jetzt wieder so wird. Lange Zeit kamen die kunstinteressierten Käufer aus Hamburg, Köln und München, da war Berlin ne trockene Schrippe, ohne Belag drauf.
Die Westberliner Kunstszene erlangte erst in den Achtziger Jahren größere Aufmerksamkeit...
Ja, durch die Jungen Wilden ist da endlich was passiert. Man musste damals schon ein Kreuz wie ein Stier haben, um in Berlin figürliche Bildhauerei betreiben zu können. Das Verständnis und die Bereitschaft, dafür Geld auszugeben, waren verschwindend gering. Anfang der Neunziger überlegte ich, nach Hannover überzusiedeln, weil ich dort einen Galeristen hatte. Gott sei Dank habe ich das nicht gemacht - jetzt fühl ich mich hier wieder sehr wohl.
Nochmal zum Wedding: Welche Bedeutung hat der Kiez für Sie?
Der Kiez ist ein langsam gewachsener urbaner Bereich, nichts Künstliches. Das merkt man auch den Leuten an: die haben das Herz am rechten Fleck und Berliner Schnauze. Und wenn man so durch Kneipen zieht, ist es schon ein anderer Menschenschlag, der hier haust. Es ist ein schöner Kiez, spröde, aber lebendig. Wenn ich abends so rumstreune, zum Deichgraf, zu Schuppke oder mal zum Inder, das ist Erholung pur. Man blickt sich um und schaut in Gesichter, die vertraut wirken. Und es irgendwann auch werden.
Der nächste große Umbruch steht in dieser Ecke der Stadt unmittelbar bevor: Die großen Brachflächen, die so charakteristisch waren für das Zentrum, sind bald Geschichte, die Mitte verdichtet sich. Macht Ihnen das Sorgen?
Natürlich macht mir das Sorgen. Es wird wahrscheinlich einen Verdrängungsprozess geben, der ist weltweit nicht aufzuhalten. Ich war oft in New York, da haben die Künstler auch erst in Soho gewohnt, dann in TriBeCa, dann raus nach Chelsea und schließlich über den Hudson rüber nach New Jersey - die Galerien immer hinterher. Das wird hier genauso sein, aber ich glaube, man muss mit dem Charme der Weddinger leben können. Und der wird viele erstmal abschrecken. Das hoffe ich jedenfalls.
Die Künstler profitieren ja auch von den rasanten Veränderungen der Stadt. Kann es sein, dass Künstler und Galeristen letztlich ein wanderndes Volk sind, das von Viertel zu Viertel zieht und nie ein wirkliches zu Hause hat?
Höchstwahrscheinlich ist das so. Wenn man die Kolumnen der Kunstzeitschriften betrachtet, wird schon darüber spekuliert, welche Stadt als nächstes zum Künstlertreff auserkoren wird, in Europa oder anderswo. Die Karawane zieht dann weiter, dahin, wo es Platz gibt und preiswert ist. Berlin hat das große Glück, zum jetzigen Zeitpunkt ein geschlossenes Feld an Galerien und vielen sehr interessanten, hochgradigen Künstlern zu haben. Die bringen Interessenten weltweit hierher. Wir Künstler sind ein Volk, das von der Gnade der anderen lebt. Wir stellen Dinge her, die nicht zum Essen sind, sondern die die Seele braucht. Erst kommt das Fressen, dann die Moral, wie schon Brecht sagte. Und die Seele kommt zum Schluss.
Hat Ihre Arbeit Bezug zum Kiez?
Meine Wagen- und Radmotive kommen daher, dass die Deutsche Bahn bei mir im vierten Stock vorbei fährt und sich alles noch ein bisschen schneller dreht dadurch. Auch die Architektur, die ich sehe, wenn ich aus dem Fenster schaue, fließt in meine Arbeit mit ein: das Geradlinige der Hausstrukturen im Wedding spiegelt sich auch in meinen Skulpturen.
Was wünschen Sie sich vom Kulturstandort Wedding, der nach wie vor der Produktions-Hinterhof der Galerien in Mitte ist?
Ich wünsche mir eine behutsame Veränderung. Wenn die Kunstszene mit aller Macht in den Wedding einbricht, werden sich die Anwohner verändern. Es wird einen Austausch von Menschen und einen Verdrängungsprozess geben, den ich nicht gutheißen kann. Ich möchte, dass die Kultur, die im Augenblick herrscht, eine Migrationskultur mit leichtem Underdog-Gefühl, bleiben darf. Diese schluffige Alltagskultur, dass man noch aus dem Fenster hängt und beobachtet, dass die Nachbarin einen anraunzt Wenn das verschwindet, ist ein Stück altes Berlin weg, da muss man aufpassen. Ich hoffe, dass es hier nicht so schnell passiert wie in Prenzlauer Berg. Denn dann ist dieses Atelier auch nicht mehr zu halten.






